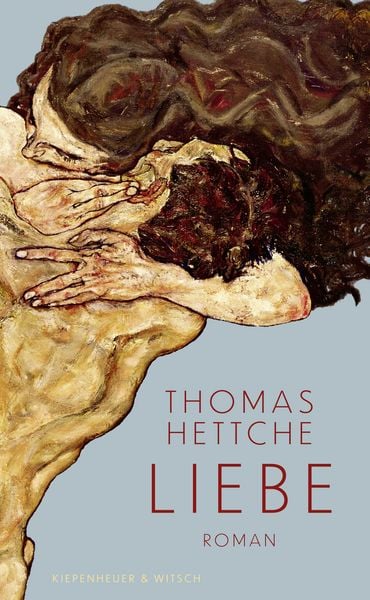Später Nachmittag, früher Abend, noch war draußen Sonne auf dem Schnee, flirrte Staub hier drinnen im Licht. Ich sah die Stille über seinem Haar; wie sie ihm um Augen und Mund sank, sah ich auch; seinen Blick, doch woher; dem freien Fall sah ich zu an jenem Abend, gleich gültig wie es ausgehen würde; mit geschlossenen Augen sah ich ihn, als hätte sich über meine Augen eine zweite, milchig trübe Haut gezogen wie bei manchen Tieren, wenn sie schlafen; Metaphern. Metaphern, wird man sagen, streute ich ihm an jenem Abend wie Sand in die Augen, nichts sonst. Aber gelogen wäre, sagte man, da sei nichts gewesen. Die Stille über seinem Haar sank mir um Augen und Mund. Auf die Theke gestützt trank er und rauchte, wartete und strich mit langsamer Drehung der Zigarette die Asche an der Mulde im Aschenbecher ab. Ich sah es; so begann es, ich traf ihn. Der Staub über dem schwarzen PVC-Boden in der Luft sah aus, als wirbelte Sand auf beim Gehen in flirrendem Licht, reflektiert von Mauern, zwischen denen windstille Luft heiß pulsiert. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, hätte ich ihn beiseite gelassen, niemand dagestanden, oder ich selbst, rauchend, wartend, wäre den Weg selbst gegangen, der sich, wie ich sah, über dem flirrenden Sand deutlich auftat; mußte ihn nur weiterspinnen; nahm ihn, an meiner Statt, er bekam Gesicht und Geschichte, nur er wurde gesehen, Köder, hingehalten, während ich darauf wartete, zu wissen, was kommt. Er gähnte. Die Zeit, hat man einmal begonnen, vergeht verläßlich, unberechenbar ist nur der Moment des Beginns, jener Punkt, in dem alles zusammenfällt; heraus mit dem ersten Wort. Später ist es einfach, zu sagen, es sei später. Er trank sein Glas leer. Auf den blau gestrichenen Wänden, ein dunkles, schwärzliches Blau, lag schon Schatten, auf der schimmernden Theke noch immer letztes Tageslicht. Musik wurde eingeschaltet. Durch das Fenster sah ich das Hochhaus der Stadtwerke, davor Maschendrahtzaun, zugeschneite parkende Autos, ein gelbes Schild, Feuerwehrzufahrt Tag und Nacht freihalten, kalt vor dem Fenster, Stühle, Stahlrohr, Kunstleder, Tische mit Metallplatten; ich folgte seinem Blick, als er das leere Glas von sich schob, über die Theke, die sich rechteckig um eine Säule aus Milchglas und Stahl legt; noch ein Bier bestellte mit einem Nicken und den Jungen hinter der Theke, blond, das Haar mit Pomade glatt zurückgestrichen, Vogelgesicht, ansah, sieht jünger aus, als er ist, dachte er und überlegte, suchte nach einem Wort, während der Junge, halb abgewandt, das Bier zapfte. Die weiße Schürze über den Jeans, gespannt um die schmalen Hüften, ist es nicht, dachte er, nicht das Geschirrtuch, das dem Jungen lose über die Schulter hing, der Blick glitt weiter, ich wartete, ließ ihm Zeit, die Manschetten der Hemdsärmel aufgeschlagen, Knabe, versuchte er es, ich ließ ihm Zeit, sollte er suchen, Knabe, erst, als ich bemerkte, daß er aufgeben wollte, steckte ich ihm, so sagt man doch, einen Namen; Theseus; warum nicht, dachte an den heißen Sand und das flirrende Licht auf dem PVC-Boden. Theseus, dachte er und zündete sich, unsicher, woher dieses Wort jetzt, eine Zigarette an. Theseus. Ich wußte, die Geschichte hatte begonnen und ich sah niemanden, der die beiden stören würde. Der Junge stellte das Bier vor den hin, der froh war, einen Namen zu wissen, und zusah, wie jener Schlieren über die schimmernde Theke wischte, ein sauberes Glas, an dem das Wasser ablief, auf dem Nirostagitter neben dem Spülbecken abstellte und dann hinter der Theke hervorkam. Es schien ihm, als wiegte der Kellner sich beim Gehen besonders auffällig in den Hüften, doch nicht wie eine Frau, sondern, dachte er, als der Junge an ihm vorbeiging ohne ihn anzusehen, mit dem schaukelnden Gang eines ausdauernden Läufers, wie eine besonders eingestellte Maschine, getunt, dachte er, hochgezüchtet; dachte an die bläulich schimmernden Ventildeckel eines Hochleistungsmotors, die sich, von einer glänzenden Ölschicht ziseliert, in gleichmäßiger Bewegung der weich geschwungenen Nockenwelle anlegen; dachte an wie filigrane Brückenbögen zitternd gespannte Hinterläufe zierlich schneller Hunde, und dieser Vergleich gefiel ihm besser; Theseus, dachte er. Der Sand wirbelte unter Theseus‘ Schritten auf. Ganz so, wie ich es mir gedacht hatte, pulsierte das Licht, reflektiert von den Wänden, heiß in der windstillen Luft des Nachmittags zwischen den hohen Mauern, die den schmalen Weg begrenzten, der sich auftat bis zur nächsten Biegung und weiter, hinaus aus der Bar. Er hörte, viel später, als er Theseus lang schon nachging, er wußte nicht, ob in Gedanken, seine eigenen Schritte, leise, hell, beinahe noch nicht; den anderen unterlegt. Die Tasche mit den Pechfackeln und dem Brot, dem Dörrfleisch, dem Seil, der Decke, schlug ihm beim Gehen immer wieder schwer in die Kniekehlen. Ganz langsam hob so die Zeit an, vergaß er das Lokal, ging immer weiter, noch nicht weit genug, noch nicht, dachte ich, ging immer weiter, gleich aber muß er beginnen, sich zu erinnern. Da sagte jemand „gelb, gelb“ und er blieb stehen. Wischte sich den Schweiß von der Stirn, auf was wartete er, es begann kühler zu werden. Die Sonne fiel schon. Schatten in den Mauernischen. „Gelb, gelb“, sagte die Stimme, nach der er sich umsah, „gelb“, der Weg verlief geradeaus weiter, „gelb“, kam es hinter der Theke hervor, hinter der Säule mit den Flaschen davor, und holte ihn zurück ins Blau des Lokals. „Welches Gelb“, fragte Theseus, der ebenfalls stehengeblieben war. Keine Ahnung, dachte ich, überrascht von der Störung, welches Gelb. „Gelb“, sagte das Mädchen einfach, immer wieder, jetzt erst sah ich es, kam hinter der Milchglassäule hervor, ging an ihm und dem Jungen vorbei und setzte sich in einer Ecke des Raums auf einen Flipper, den ich zuvor nicht bemerkt hatte. Ein Rapsfeld, Ginster, Löwenzahn. Doch das Mädchen lachte nur, kurze Hosen, flache Sandalen, dicke Kinderknöchel, sagte „gelb, gelb ist geil“. Er wiederholte sich unruhig, was er wußte, gelb ist der Himmel über den Mauern, aber die Wände sind blau, „gelb, gelb“, hörte er das Mädchen, die Wände sind blau, die eine, alle, wieviele, es lachte, ich könnt Theseus ein Markstück geben, dachte er, dann rückte es sicherlich beiseite und spielte Flipper mit ihm, hülfe uns, wir dürfen nicht hierbleiben, gelb, hat es gesagt, durch das Labyrinthes, dachte er. Sag es ihm, stimmte ich ihm zu, sag ihm, er soll mit dem Mädchen spielen, blau sind die Wände, fiel er mir ins Wort, geh weiter, forderte ich ihn auf, um diese Ecke noch und jene, durch Damentoilette und Herrentoilette hindurch, weiter an den langen Reihen der Pissoirs vorbei, doch die Räume schoben sich übereinander, die Bar und das andere, dessen Wort er jetzt wußte, ich wiederholte es ihm, Labyrinth. Das Mädchen saß auf dem Flipper, er sah es im Augenwinkel, the cure lauter und lauter, „whenever i am alone with you“, „gelb“, sagte es, warum flippert Theseus nicht, dachte er, gib ihm eine Mark, lockte ich, du mußt weiter, weißt den Weg. Der Junge drehte sich um nach ihm, wollte wissen, was los sei, fragte, „was is“, doch er hörte ihn nicht; begann endlich, sich zu erinnern. Wie sie zusammen über verdorrte Hügel gehen im Sommer, Ginster, durch Dörfer, wir bleiben über Nacht, dachte er, ich schlaf ihm zur Seite, weiß, was er träumt. Weiter, versuchte ich ihn anzuspornen, spürte, wie er, als verbänden sich Rinnsale und Pfützen bei Regen, immer mehr von sich zu wissen begann, weiter, weiter, lockte ich ihn, komm, ich steh an Anfang und Ende, wart beidseitig auf dich, hab keine Angst, nun geh schon, nimm ihn an der Hand und erinner dich. Ich könnte, dachte er, mit geschlossenen Augen seine Brust, seinen Bauch, sein Gesicht in Gedanken ertasten, so gut kenn ich ihn. Erinner dich doch, half ich ihm, wie du ihm die schmerzenden Beine mit duftendem Öl begießt, wie er sich herumwirft auf den Bauch, du streichst mit der Zunge über die glänzende Haut; hoffte, daß er nun endlich vergesse, woher er stammte, mir, nicht auf die Schliche, auf die Spur komme, die ich ihm gelegt hatte, am Rattenschwanz dieses Namens entlangfinde in seine Vergangenheit hinein. Doch das Lokal verschwand nicht, Theke, Gläser und Flaschen blieben, der Flipper und die Türen standen rund um das Mädchen, das ich übersehen hatte im toten Winkel hinter seinem Rücken. Was will es. Gelb hatte es gesagt und gelacht, fügte sich nicht ein, zwischen Flipper und sandigen Weg, auf dem die beiden warteten, stand es und reichte in beides hinein, den Fuß in einer Tür, die man nicht sah; und Theseus wartete noch immer regungslos und starrte es an. Er glaubt mir nicht, dachte der andere, daß ich es nicht kenne, nicht wußte, daß wir es hier treffen würden, wie erklär ich ihm das. Immer mehr fühlte er sich ein in den Mund, den ich ihm zum Sprechen gegeben hatte. Jetzt konnte er sagen, daß Theseus ihn mitnimmt auf allen Fahrten. Morgens, dachte er, bin ich dafür da, ihm zu sagen, wer er ist, und abends, ihm die Angst zu nehmen vor der Nacht, dem nächsten Tag. Ich weiß den Weg. Gelb, gelb, hat das Mädchen gesagt, wiederholte er sich immer wieder, wußte nicht weiter, sehnte sich so sehr zurück in was er erinnerte, als wüßte er, daß er es niemals erlebt hatte; wie die eigene Kindheit auf gefälschten Photos. Beweise. Aus welchem Film ist das. „Irgendwer wartet immer“, sagte der Junge, der Barkeeper, der Knabe, Theseus. Doch er bemerkte nicht, daß er gemeint war, versuchte stattdessen, sich zu erinnern; was war, gehört mir, dachte er und tastete sich sein Leben zurecht, zurück, egal woher; sagte sich, ich weiß, wie Theseus es macht, sah den lange an, den er so nannte, weiß, wie er es macht; stellte sich vor, Theseus faßte das Mädchen mit seinen Händen und höbe es vom Flipper herunter; nähme er es doch, wie schon einmal, wie immer, wie er alle nimmt, die staunenden Beine auseinander, die warten darauf, wissen nicht weiter, was wissen die schon, nichts weiter, sein Griff wär ihnen geschmeichelt; Kindheit, dächte das Mädchen, und wüßte nicht, warum; wissen nichts anderes als Kindheit, überlegte er, und in seinen Armen spüren sie zum ersten Mal dann Alter. Es fiel mir schwer, zu verstehen, was er diesem achtzehn, vielleicht neunzehnjährigen Jungen alles zuschrieb, gern hätte ich seinen Blick gehabt, für einen Moment nur, seine Augen. Das Mädchen weiß nichts, wir müssen weiter, dachte er, hörte das Schnauben des Tieres von weit; sah, der Himmel ist gelb, der Sand ist schwarz, die Wände blau; dachte, ich möcht verschwinden unter seinen Füßen, da ist der Sand, nicht unter meinen; dachte, jetzt nimm es schon und leg es beiseite, wie immer, wie damals, wie ein Kind beim Pissen in deine Armen die Kleine, der Geschmack der Vagina, der süße, pludrige Geruch ihres Anus, sandbestäubt, zinnoberrot, dachte er. Doch der, den er Theseus nannte, stand noch immer, die weiße Schürze um die Hüften und das Geschirrtuch lose über der Schulter, vor dem Mädchen, das im Schneidersitz auf dem Flipper saß und ruhig abzuwarten schien. Wind trieb ihnen Sand um die Beine, in die geschlossenen Münder, daß das Schweigen knirschte, warum gehen wir nicht weiter, fragte er sich, warum bleibt Theseus einfach stehen, spiel mit dem Mädchen, dachte er, gib ihm eine Mark oder zwei, unter den Füßen schmerzte ihn der Quarzsand, glitzernde schwarze Funken, als wären es Kiesel vom Strand, von dem sie beide, wie er glaubte, kamen. Blau ist der Faden, dachte er. „Gelb“, sagte das Mädchen, schaute ihn nicht an, das Licht des Abends balancierte tief über den Mauerkränzen; der Junge fragte, „wie geht es dir“. Wie lange es wohl gedauert hatte, das alles zu bauen, was vor dem Labyrinth hier gewesen sein mochte, Steine und Gras, er stellte sich vor, wie die Arbeiter die Ziegel vom Meer hier heraufkarren, sich über den Plan beugen auf einem großen Stein, den sie ganz zuletzt ausgraben und wegrollen. Es weiß keiner, wie weiter, wo lang, dachte er; nachts könnte man es berechnen mit den Sternen wie auf dem Meer, schöben sich nicht die Mauern fugenlos vor den Blick; aber ich weiß den Weg, ich weiß nicht, woher. Als hätte Geruch vom Meer sich hier verfangen, wäre windstill versickert zwischen den Mauern, roch er Algen, Schaum, nassen Sand, ein wenig auch Eukalyptus aus den hohen, schwankenden Blättern über dem Weg herauf. Dem Geruch könnte man folgen hinaus, überlegte er, hinein dem scharfen Dunst nach Tierschweiß und Mist; manchmal schabte es hinter den Steinen entlang, daß der Faden zitterte davon. Jetzt erst sah ich, der Junge hielt einen Wollfaden um den Zeigefinger geschlungen; in der geschlossen Faust das Restchen des Knäuels, das ihnen noch geblieben war. Es ist nicht mehr weit, dachte er, was warten wir noch, ich weiß, es bleibt keine Zeit, es wartet auf uns; seltsam, daß es weiß, wo es ist, und doch nicht hinausflieht. Er sah, wie die Federn an den geschmückten, weichledernen Stiefeln Theseus‘ wippten, hörte ganz leise den hellen Klang der kupfernen Schellen, es schien ihm, als sänge das Mädchen, doch kein Lied; summte, doch keine Melodie; Theseus Rücken verdeckte ihm das Gesicht. Er beugte sich vor ins Licht und spürte blinzelnd die letzte Abendsonne, die ihm tief über die Stirn hing und Schattenfurchen unter die Tränenssäcke grub, rot unter den Wolken hervor auf seinen Augäpfeln. Und den roten Widerschein sah er auf denen des Mädchens, das seinen Blick erwiderte, überrascht, als entdeckte es ihn erst jetzt, an dem Jungen vorbei, der noch immer, aber ich weiß nicht, wieviel Zeit vergangen war, dastand und sich mit den beiden Händen über das Haar fuhr, es strähnig glatt anlegte, mit den Füßen wippte und den ganzen Körper auf Ballen und Fersen wiegte dabei. Die eigene Unruhe, der Wunsch, daß es endlich weitergehe, erinnerte den anderen daran, wie fremd ihm alles war, daß er nur möglichst schnell sich von einem zum nächsten Geschehen retten wollte, ich wußte, er spürte, ohne es zu wissen, daß er aus Splittern bestand, seine Wünsche, Erinnerungen, Absichten Reste waren, Stümpfe, abgelegte Prothesen, gebrauchte Einzelteile, die knirschten und scheuerten in der Bewegung. Und auch ich wollte, daß es vorangehe, doch die Anwesenheit des Mädchens, als saugte es auf, was er dachte, zerstörte wie ein optisches Geräusch das Bild, in dem er sich gerade zu bewegen begann, und ich wußte nicht, wie ich das Mädchen integrieren sollte, es war nicht vorgesehen, keine Leerstelle fiel mir ein, die es hätte besetzen können, ich konnte nichts gegen die Vermengung der beiden Ebenen tun, die ich nicht vorausgesehen hatte und die ihn zu paralysieren schien; wenn ich auch die Mechanik des Ablaufes begriff, wußte ich doch vom einzelnen Geschehen nicht mehr als er. In meiner Erfindung sah ich mit seinen Augen, und was das Mädchen sagte, war mir so unverständlich wie ihm selbst. Doch noch schien der Stillstand Zeichen seiner Bemühungen, es zu integrieren, ich spürte, wie er, was er wußte, daraufhin zu lesen und abzutasten versuchte, ob etwas dabei wäre, was ihm den Zugriff ermöglichen, es konvertieren könnte, und sein Suchen nach Namen, zinnoberrot, sandbestäubt, war nichts als vorläufiges Ergebnis, noch war nicht entschieden, ob es zu einer Abstoßungsreaktion kommen oder die Geschichte mit dem Mädchen funktionieren würde. Wenn es nur einen Moment stillstände und aufhörte, Neues zu produzieren, dem er nicht nachkam. Doch in dem Moment, als er zum ersten Mal sich im Blick des Mädchens verfing, war es, als bekäme plötzlich eine Simultanübersetzung ihres Summens, und er verstand, ohne daß sich an seiner Wahrnehmung etwas änderte, was es sagte so, wie man bei Fernsehern mit Stereokanalsystem Originalton und Synchronisation zugleich hören kann. Es redet an anderem Ort mit mir, dachte er, Sirenengesang, und da ihn diese unerwartete Veränderung ängstigte wie eine plötzliche Berührung, rief er zu Theseus, der ihm noch immer den Rücken zukehrte, hinüber, „laß uns gehen, schnell, komm“. Der Junge drehte sich um, doch als er sah, daß der andere wieder schwieg, zuckte er nur verständnislos mit den Schultern und wandte sich wieder dem Mädchen zu. Das ist eine andere Geschichte, flüsterte ich ihm, sei still, doch er versuchte es weiter. „Machen wir, daß wir hier wegkommen.“ Das Mädchen schüttelte den Kopf wie nebenbei, und suchte den Blick des Jungen. „Hast du Streichhölzer.“ „Nein“, antwortete der Junge und klopfte zur Bekräftigung, seine Taschen seien leer, mit beiden Händen Schürze und Hemd ab. „Schade“, der Blick des Mädchens glitt weiter, wieder zurück zu ihm, „und du“. Er schüttelte hastig abwehrend den Kopf, begriff nicht, auch wenn er jetzt verstand, was es sagte, wie es hierher, in das Labyrinth, geraten war. Es dunkelte schon ins Schwarz. Es wird spät, dachte er, wir müssen weiter. Das Mädchen streckte langsam die Beine und ließ sich vom Flipper gleiten. „Komm her“, die kleinen Hände zu Fäusten geballt in den Taschen der kurzbeinigen Jeans, stand es, ein wenig vorgebeugt, neben dem Jungen, den es nicht beachtete, „wir müssen miteinander reden“. Er schüttelte wieder den Kopf, sah zu Theseus hinüber. „Dann komm mit“, forderte es ihn auf, während der Blick des Jungen verwundert zwischen beiden hin und her sprang, dem Mädchen nach, als es an ihm vorbeiging und dem anderen mit der Hand winkte, der keine Vorstellung hatte, was es von ihm wollte, daran dachte, er könne Theseus doch nicht hier alleinlassen, Zigaretten und Feuerzeug auf der Theke vergaß und dem Mädchen durch eine Tür in der blauen Wand in die Damentoilette folgte, an Spiegeln, Waschbeken und Heißlufthändetrocknern vorbei, dann hinter den Kabinen unter Entlüftungs- und Heizungsrohren hindurch, an Verkabelungen und Wasserleitungen entlang; warum kennt es sich hier aus, fragte er sich, hörte das schlürfende Knirschen der Sandalen auf dem Sand. „Was willst du“, fragte er schließlich und blieb stehen. „Nichts“, sagte das Mädchen ruhig und drehte sich um nach ihm, „ich will nur“, fuhr es fort und ging dabei wieder langsam zurück, auf ihn zu, blieb stehen, und als er einen Schritt zurücktrat, kam es ihm nach, immer dicht vor seinen Augen, „will nur Feuer“, und hob die Hand, in der es noch immer die unangebrannte Zigarette hielt. „Hab ich nicht, tut mir leid“, entschuldigte er sich in das breite Lächeln hinein, mit dem das Mädchen, kaum schwieg er, wissen wollte, und es schien ihm, als ob das Lächeln eine Farbe hätte, die flackernd sich änderte für einen Moment von gelb nach blau, „was ist nun mit uns zwei“. „Ich weiß den Weg“, sagte er leise. „Ficki-Ficki“, fragte es. „Was willst du von Theseus“, flüsterte er, ganz nah am Gesicht des Mädchens, doch da schloß es die Augen, begann leise zu flüstern, er verstand es nichts mehr, hörte wieder nur ein Gurren, daß nach gelb, gelb klang, dann das Summen, wie selbstvergessen irgendwo über der Kinnlade, die kantig und knochig die muskulösen Wangen begrenzte, unter den großen Augen, über die sich die Lider wie Kuppeln geschlossen hatten. Sah die Bewegung der Augäpfel unter der gespannten Haut. War so nah vor dem Gesicht, daß das Mädchen seinen Atem spüren mußte auf den Wangen. Lauschte auf das Summen, das Geflüster, gelb, gelb, und begriff nicht, daß es nur sein eigenes Unverständnis war, was es vor ihm verbarg. Unter den Lidern sieht es, dachte er, was ich nicht seh, und das ist, als lachte es mich aus; was ich seh, weiß ich, doch nichts von ihr, nur an ihre Gestalt heran komm ich, nicht näher an sie als eine Tangente dem Kreis, in sich sofort wieder entfernender Linie. Einen Moment lang glaubte ich, es gelinge ihm tatsächlich, aus seinen Erinnerungen auszubrechen; als glitte er sehr dicht an mir vorüber, spürte ich ihn, spürte ihn beinahe körperlich wie einen Luftzug ganz nah an der Grenze der Erfindung. Ich seh ihr Gesicht, dachte er, aber ich weiß nicht, wie weit, weiß nichts weiter, nicht weiter, als ich sehe; die Fremde bleibt in den Kuppeln der Lider, in den Augenbrauen, die zuckend unregelmäßige Bogen schlagen über diesen Kuppeln; die Haut unter ihren Augen ist porig, sag ich, ohne zu wissen, was es heißt. Das, was fremd bleibt, ist. Die Unterlippe. Vorgewölbt und rissig wie das ausgetrocknete Stück einer Apfelsine. Fremd, wie es ist, bleibt es. In Vergleichen bleib ich, bleib bei mir selbst, komm nicht heran. Mit angehaltenem Atem lauschte ich darauf, wie er den immergleichen Gedanken um und um warf und die Grenze zu mir entlangschlitterte, blieb ganz still, wußte, es war zu spät, ich konnte an der Anwesenheit des Mädchens nichts mehr ändern, das noch immer mit geschlossenen Augen dastand, als erwartete es die Antwort auf das Angebot, das es ihm unter den Heizungsrohren und Kabeln, zwischen den blauen Wänden auf dem hellen Sand im Halbdunkel gemacht hatte; draußen mußte die Sonne schon untergegangen sein. Er betrachtete die pochende Halsschlagader, die Falten weit unter dem Kinn wie dünne Ketten; die fast unsichtbare Spur des Flaums vor den Wangenknochen zur Kinnlinie hinab. Doch es atmet, dachte er, und ich weiß nur wie; anderes, was ich nicht sehe, geschieht wirklich stattdessen, ich kann nichts dagegen, bleib in meinem. Er stellte sich vor, wie über die Lippen, die er vor sich sah ganz nah, die Zunge leckte; den Luftzug am Hals des Mädchens, die Haare auf der Haut sah er; phantasierte sich, wie es das Reiben der Augäpfel an den Lidern spüren mochte; dachte, ich weiß von Haut und Haaren weniger, als sie sind; nur Vergleich und Beschreibung; komm nicht hinter das Gesicht. „Nicht schlagen, nicht schlagen“, sagte da das Mädchen plötzlich, „nicht mit der Faust“, und riß, als gäbe es sich einen Ruck, die Lider hoch, Angst im Blick, „nicht schlagen“. Doch als es sein verwundertes Gesicht sah, leckte es sich blitzschnell über die apfelsinentrockenen Lippen und begann zu lachen, lachte aus dem Summen, dem Singsang, der die ganze Zeit nicht aufge- hört hatte, lachte und drehte sich weg; ging den Gang wieder hinunter, den sie gekommen waren. Als er die Tür der Damentoilette hinter sich schloß, saß es schon wieder im Schneidersitz auf dem Flipper, beugte sich vor zu dem Jungen, legte ihm eine Hand in den Nacken, und flüsterte ihm etwas zu. Der Junge lachte, schüttelte den Kopf, und kam, als der andere, der wieder an der Wand, am Tresen lehnte und nicht verstand, was geschah, den Blick schweigend erwiderte, herüber, lehnte sich neben ihn an die blaue Wand und schnallte lächelnd den Gürtel ab, ließ die Axt auf den Boden ganz langsam. Der Junge hatte die Schleife der Schürze aufgezogen und sie achtlos auf die Theke geworfen. Kühl ist das Blau. Das Mädchen strich sich über die Beine und löste die Riemen der Sandalen. Fielen in den Sand. Das Geräusch des Aufschlages auf dem PVC-Boden, ein dumpfes Knarren des Leders, helles Knirschen des Sandes, hörte ich überdeutlich, denn im selben Augenblick setzte die Musik aus, ich dachte, das Tonband sei zuende, Stille, doch dann hörte ich überhaupt keine Geräusche mehr, sah, das Mädchen zog die Beine an den Körper und rieb sich Fußsohlen und Zehen, Stummfilmbilder, jetzt lachte der Junge, sah den Mund still sich bewegen und hörte, wie der andere dachte, lach nicht, worauf warten wir denn, lach nicht, hast doch Angst, ich weiß es, jetzt läßt du, was soll das, fahren alle Vorsicht, als wären wir auf dem Schiff, zuhaus, nicht hier zwischen den blauen Mauern und diesem Mädchen, das gelb sagt, gelb, nicht mehr, gelb, nichts sonst, was warten wir denn, später, überlegte er und erinnerte sich, wie es sein würde, später halt ich dich wieder, geb dir zu trinken, zu essen, reib dir den schmerzenden Arm, spiel Backgammon mit dir, wärem dich, wenn du zitterst wie Laub neben dem Feuer, alles, nur jetzt müssen wir weiter, was warten wir noch. Er bemerkte nicht, daß der Junge den Blick nicht von ihm ließ, noch immer grinsend neben ihm lehnte, mit einem seiner Stiefel sich an der Wand abgestützt und sogar ein wenig gebückt hatte, um ihm ins Gesicht sehen zu können, und erst, als mit einem Mal ein Brei von Geräuschen wieder über die Bilder schwappte, der Flipper, Stuhlbeine, das Tropfen des Wasserhahns, die laufende Spülung, der Kühlschrank, Sand, Wind, Atmen auch, Räuspern, als das Mädchen vom Flipper herüberrief, er solle ihn in Ruhe lassen, „der kann doch nichts dafür, ist eben völlig besoffen“, und der Junge über die Schulter antwortete, „laß mal, ich will mir den Schlappschwanz nur mal betrachten“, schaute er auf, als wäre er mit einem Mal erwacht, trat einen Schritt vor, ganz nah an Theseus heran, und flüsterte ihm von unten herauf schnell zu, „komm, es hilft nichts, komm weiter, zuhaus warten andere, Knabenärsche soviele du willst, sind wir erst raus hier, es weiß nichts, es heilt nichts, das Mädchen“. Der Junge zuckte überrascht mit dem Kopf zurück und zischte ihn an, „halt’s Maul, du schwule Sau, laß mich in Ruhe“, und lauter über die Schulter zum Mädchen, „der ist nicht besoffen, der ist stockschwul, so eine schwule Sau“, während der andere ihm schon nachkam im Schutz der Schulter die wohltuend kühle Wand entlang, und flüsterte, als wollte er den Jungen überreden, ganz nah an dessen Ohr, „komm, glaub nicht, was es sagt, Held, komm weiter, lach nicht, ich weiß den Weg, was wartest du denn“. Doch der Junge stieß sich mit dem Westernstiefel von der Wand ab und ging, ohne ihn anzusehen, wieder zum Flipper. Er hört nicht, wie auf der ganzen Fahrt, die ganzen letzten Tage hört er nicht; sitzt wortlos auf den fest geschnürten schwarzen Segelballen, spricht mit keinem, hat Angst, natürlich, sieht nicht einmal auf, wenn man vorbeigeht oder ihm sein Essen bringt, keiner traut sich, ihn zu fragen, ich weiß sicher, daß es die Angst ist, kenn ihn doch. Der Junge, der wieder vor dem Mädchen stand und breitbeinig auf den Absätzen wippte, zog ein Päckchen Marlboro aus der Hüfttasche seiner Jeans, Stein und Zunder aus seinem Schurz, schlug Funken, das Mädchen löste die verschränkten Beine, schloß beide Hände als Windschutz um die Flamme und brannte die Zigarette an, „danke“. Das Knäuel fiel auf den Boden. Der Junge gab dem Mädchen eine Mark, es rauchte, warf das Geldstück ein, er zündete sich eine Zigarette an, ließ mit dem chromglänzenden, federnden Bolzen die Kugel wegschnellen, spielte mit den Knöpfen, den zuckenden Flügeln unter dem Mädchen, und es schloß lächelnd die Beine um seinen Arsch; rief, an Theseus Rücken vorbei herüber zu ihm, „mach doch mal zwei Bier“. Ich weiß noch, dachte er, und ging ohne nachzudenken an der blauen Wand entlang durch den schon dunklen Sand um die Theke herum zum Zapfhahn, nahm zwei Gläser aus dem Regal hinter sich, ich weiß noch, die Küste im Rücken, der Stewart bringt den Whiskey, wir stoßen an auf das Gelingen der Fahrt, ich seh sie noch winken am Strand, die wehenden Haare, die Feuer, Asche fliegt, die Musik des Orchesters von weit, das Nebelhorn antwortet dröhnend, die Segel schlagen im Wind, der Dieselmotor stampft tief unten im Schiffsrumpf, die Ruder tauchen zischend zu den Taktschlägen ins Wasser, am Heck schäumt es um die Schraube, der Steuermann an der Ruderpinne blinzelt in die Sonne, sein Gesicht grün überzogen von den Spinnweblichtern des Radarschirms und der Anzeige des Echolots auf der abgedunkelten Brücke, ich weiß noch, wie Theseus erzählt von seiner Angst, daß sie ihm keiner glaube, von den Küssen, die allen so gut schmecken wegen der Angst, die sie spüren, nicht erkennen in ihnen; er zapfte das Bier ohne Widerspruch, sah hinüber zu dem Mädchen und Theseus am Flipper, dessen Gesicht in den Lichtern des Apparates stand wie im Widerschein eines Feuers, hörte das Tackern der Kugel gegen Plastik, gegen Metall, Glas, sah, Theseus beugte den Kopf tief vor dem Mädchen; als striche es ihm über das Gesicht, legten sich die Farben um und um darauf. „Gelb ist geil“, hörte er es sagen, dachte, es reicht, wir müssen weiter, es gibt kein Freispiel, ich kenn doch Anfang und Ende, weiß den Weg; „weiß den Weg“, murmelte er, doch die beiden beachteten ihn nicht. Er hat Angst, ich weiß es, beruhigte er sich, kenn ihn, er fickt jeden Arsch, den er findet, aus Angst, weiß ich doch, ich bin es, der den Weg weiß, du sollst mich nicht vergessen, hörst du, darfst mich nicht vergessen, brauchst mich, hab keine Angst, komm, ich halt dich, zeig dir den Weg, sag dir, was du tun sollst, Held, „laß doch die Fotze“, murmelte er. Der Junge drehte sich um zu ihm, „fick dich selbst“, zischte er zur Theke hinüber, doch das Mädchen hielt ihn mit den Beinen um die Hüfte, sagte beruhigend, „laß doch den Wichser“, und er spielte weiter. Gelb ist der Himmel, blau sind die Wände, das Knäuel, dachte er, ich halt es für ihn, gelb, sagte das Mädchen, gelb ist geil, mehr nicht, mehr weiß es nicht. „Doch“, sagte das Mädchen, „blau ist der Himmel, blau ist er“, herüber zu ihm, der von den Gläsern aufschaute und dachte, gelb ist der Himmel, gelb, das ist meine Geschichte, auch wenn Theseus das vergißt, wie ein Spielzeug, daß man aufziehen muß immer wieder von Neuem, das ist meine Geschichte, der Himmel ist gelb und nicht blau; wie Theseus dasteht, wie sein Rücken zuckt in der Bewegung der Hände, er muß sich nicht umdrehen, ich kenn den Schwung seiner Lippen, kenn seinen Blick; immer, immer, dachte er, als läge es an ihm, dafür zu sorgen, daß wieder geschehe, was sich unzählige Male schon zugetragen hatte. Ich beobachtete, wie sich die seltsame Empfindung, er habe etwas einzulösen, in ihm festzusetzen begann, ihn selbst überraschte, was mir alles einfällt, dachte er, und, wie konnte ich das nur vergessen; wußte nicht, daß er sich an eine Geschichte klammerte, deren Ende längst bekannt war, sah noch immer nicht die Leimrute des Namens, an der er hing; Theseus, Theseus, dachte er. Und weiter. Die Segel, das Schwarze, das Weiße, die Ruder. Ariadne schließlich. Nein, schließlich das Tier. Doch davon weiß Theseus nichts. Nichts vom Blut. Ariadne. Als wir aufbrechen, ganz früh am Morgen, hängt ihm der Speichel im Mundwinkel, zittern seine Nasenflügel vor Aufregung, ich trag ihm den Seesack, sein Diener, sein Clown, denken die andern, komm ihm kaum nach, so eilig hat er es, läuft er zum Schiff, aber davon weiß er ja nichts mehr, vergißt immer, immer vergißt er, sieht sich nicht einmal um nach der, bei der er die Nacht gelegen hat, hab ich ihm besorgt, damit er die Angst vergessen sollte, doch als ich ihn frage, ihm nachrufe, den Sack auf der Schulter, geh nicht so schnell, wart doch, wie sie gewesen sei, zuckt er nur mit den Schultern, wisse er nicht mehr, ich seh noch ihr schwarzes Haar vor dem Haus, er sieht nur den Arsch eines seiner Gefährten, schweigend gehen sie vor ihm, langsam, zögernd, jeder seinen Sack und die Waffen ängstlich über der Schulter, und er schnell ihnen nach, den Blick auf dem Arsch des einen, sieht seine eigene nackte Angst darin, den will er haben für die erste Nacht auf dem Schiff, schwört sich, den rett ich vor allen andern, wenn nötig. Gelb ist der Himmel, nicht blau. Als wir die Zykladen passieren, am Abend, wie ich es geplant und berechnet habe, im schönsten Licht, hockt er auf dem Segelballen und starrt vor sich hin, sieht nur die Angst, nicht die Sonne über den Felsen, nicht die Umsicht, mit der ich die Expedition geplant habe, aber woher soll er auch Zuversicht haben, sieht ja nicht nach vorn, was weiß Theseus schon, „was weiß er schon“, murmelte er, während er noch immer am Tresen stand, den Zapfhahn, wenn der Schaum in den beiden Gläsern zusammengefallen war, kurz öffnete, dabei auf die wässrige Spüle hinuntersah, in deren mattem Metallglanz er ein wenig vom Umriß seines Gesichtes erkennen konnte, und dachte, ein gutes Pils braucht seine sieben Minuten. Das Mädchen sah manchmal vom Flipper über die Schulter des Jungen herüber zu ihm, und wenn es durch Zufall seinen Blick fing an ihm vorbei in die dunkle Ecke des Raumes, als beachtete es ihn nicht; hörte, daß er vor sich hinsprach, und rief schließlich, wie man einem Plattenspieler, dessen Nadel durch einen Kratzer immer wieder dieselbe Rille abtastet, einen Stoß gibt, wann denn das Bier endlich fertig sei. Was macht das Mädchen auf unserem Weg, fragte er sich, aus seinen Gedanken aufgeschreckt, und was zugleich in dieser Bar, die nur es allein präsent zu halten schien, deren Konturen wie ein Kopfschmerz unter der Oberfläche der blauen Wänden des Labyrinthes undeutlich schmerzhaft wie eine stechende Ermüdung der Augen hindurchpochten, daß er sich unausgesetzt anstrengen mußte, die Umrisse scharf zu sehen. Warum mischt es sich ein, fragte er sich, rief, „kommt schon“, ging um die Theke herum und stellte die Gläser auf den Rand des Flippers neben das Mädchen, das mit einem Schaukeln des Körpers ein Stück zur Seite rückte. Gelb, dachte er, als er sich umdrehte zurück zum Tresen, zur blauen Wand, gelb ist der Himmel und das Tier, davon kann es nichts wissen, was weiß es davon, blau ist der Himmel, sagt es; gelb ist das Tier, das kann es nicht sagen; was das Tier ist. Was ist das Tier, wollte ich wissen; ist der eigene Sturz, antwortete er mir so selbstverständlich, als folgte er nur seinen Gedanken. Kaum sieht man es, wirbelt alles durcheinander, aber ich weiß nicht, was davon lebendig ist und atmet; ist auch besser so, viel besser, sagte er sich, als zu glauben, das überqellende Fell des fleischigen Halses, die Kuppe, die Hörner, das alles sei wirklich zusammengesetzt mit der sonnenverbrannten, roten, schuppig zerfetzten Haut des Körpers, in der die beiden hellen, kleinen Brustwarzen leuchten wie eine Erinnerung. Aber wenn ich im Fallen hinaufsehe zu den starr glänzenden Kuhaugen, deren Blicke sich nach den Seiten leer und unbeteiligt spreizen, seh ich manchmal ein Aufblitzen in den feuchten Kugeln wie ein verständliches Wort, doch das zieht mich nur noch näher und näher, im freien Fall, auf die Narbe zu, oder wie soll man das nennen, überlegte er, legte das Gesicht in die Hände, um sich zu konzentrieren, das Bild zu vergegenwärtigen, kann man den klaffenden Graben, an dem sich die Teile aneinander scheuern, an dem Fell und Haut ineinander enden, irgendwie, ich weiß nicht wie, Narbe nennen, es ist keine Narbe, nein, kein rotaufgedunsenes, blutpralles Wundgewebe, auch kein verheilter Schnitt, nicht einmal so etwas wie eine Teilungsnaht, eine Grenze, an der das Verschiedene zusammengeflickt wäre, keine Grenze ist es, nur eine Linie, die keinen Halt bietet; aber etwas Greifbares schon, suchte er nach der richtigen Formulierung, doch etwas Greifbares, an dem die Hand abrutscht, ein Begriff, der sich nicht ähnelt, ein Dorn im Auge, Schmerz, in den man stürzt. Nichts hält sich daran. Wie sich auch in den schmutzigen Menschenhänden des Tiers nichts hält, die sich kraftlos öffnen und schließen, versuchen sie, etwas, ein Strohbündel, ein Wassergefäß, Stoffetzen, Knochen, was verstreut dort auf dem Platz liegt, zu fassen; es entgleitet ihnen, als wäre die Erinnerung zu schwach an das, was Festhalten hieße. Nichts hält sich. Keine Beschreibung. Kein Vergleich. Keine Metapher. Als träumte es, was das ist, kratzt sich das Tier; dort, wo die schorfige Haut juckt, wo Fliegen sitzen, kratzt es sich zitternd mit den langen Nägeln, doch als gelangte der eigene Schmerz nicht über die Grenze zwischen Körper und Kopf hinweg, ritzt es sich selbst unbemerkt, mit den Nägeln die Haut, blutige Striemen. Neugierig verfolgte ich, wie in dem, was er seine Erinnerungen nannte, das Rinnsal der Geschichte langsam und zähflüssig sich einen Weg suchte, und betrachtete überrascht die Bilder, die bei seinen Versuchen, die eigene Geschichte aus den wenigen Indizien, die ihm gegeben waren, zu konstruieren, immer deutlicher und detailgenauer wurden und schließlich begannen, seine Gegenwart von allen Seiten zu überlagern und zu überwuchern; endlich setzten sich die Bilder gegen die Konturen der Bar durch. Ich flüsterte ihm meine Fragen zu, damit er weitermache, wie meinst du das, ich versteh nicht, erzähl, und tatsächlich erreichte ich, nachdem er einen Moment zu überlegen schien, woher die Irritation seiner Gedanken kommen mochte, daß er fortfuhr; noch einmal also, der Sturz. Wenn ich es sehe, das Tier, fall ich, bodenlos aus dem Blick heraus, versteh selbst nicht warum, falle, und faß im Fallen eines der Hörner, das sich widerwärtig anfühlt, ist alles zugleich in meiner Hand, glatt und rauh zugleich, hart und doch geschmeidig, als gäbe es dem Griff nach, staubig trocken und feucht, von Blut vielleicht, ich weiß nicht, oder meinem Schweiß, fürchte, daran abzurutschen, und weiß doch, ich werde mich sicher halten können, hab ich das Horn einmal gefaßt, und zugleich wird es gehalten von mir, in meinem Sturz, in den die Spitzen der Hörner hineinstechen mit einer sanft schwingenden Bewegung, die das Fallen kappt wie ein Schnitt, und zugleich läuft es mir durch die Hand, sanft nur gelenkt von mir, in die unverletzte Haut des Helden. Erst wenn das Horn ins Fleisch fährt, der Geist in die Puppe, komm ich zur Ruhe, wird mein Fall langsamer, und, er erinnerte sich zögerlicher jetzt, als wäre es ihm peinlich, und dann sag ich, er heißt Theseus, sag ich dem Tier; als spürte er mein Unverständnis, begann er, sich zu rechtfertigen, ich weiß, das darf ich nicht, weiß es im selben Moment und ziehe das Horn wieder heraus, zieh es heraus, das kann ich, weiß nicht, warum, ein Blick der feuchten Augenkugel im Schatten des Horns trifft mich wie Lachen, das Tier versteht mich, ich zieh das Horn wieder heraus unter diesem Blick, rückwärts der Film, etwa so ist es, schließt sich die Wunde. Sein Blick ruckte aus den Gedanken plötzlich hoch zu Theseus, als müßte er sich dessen Anwesenheit versichern, und als er sah, daß der Junge noch immmer am Flipper stand vor dem Mädchen, wiederholte er, die Wunde schließt sich. Keiner sieht es, nur das Tier weiß, daß ich lüge. Ich sah in grellem Mittagslicht das Bild, das er dachte. Als rieben sich die Teile des Tieres blutig aneinander, schrammten übereinander her, lacht es. Es lacht mich aus, dachte er; daß Theseus es besiegt, ist Lüge; es ist stärker als er, wartet im Innern des Labyrinthes, in der Mitte, weiß, wo es ist, und flieht doch nicht hinaus; ist stärker; keiner weiß, daß Theseus sterben müßte, es nicht tut, wieder hinausgeht, immer wieder, und vergißt, was wirklich war, noch während er geht, dem Faden nach, der braucht ihn, darum darf er nicht sterben, doch ich weiß, es ist stärker als er, „ist stärker“, murmelte er und schlug, als er bemerkte, daß er diesen Satz laut gesprochen hatte, eine Hand vor den Mund. Das Mädchen sah die schnelle Bewegung im Augenwinkel, hörte auf, den Jungen im Nacken zu kraulen, und schaute neugierig herüber, und auch er, der noch immer mit gesenktem Kopf flipperte, sah hoch, doch es nahm seinen Kopf mit beiden Händen und drehte ihn weg, „spiel weiter“. Weiter, weiter, wiederholte er, ließ den Blick nicht von dem Mädchen, weiter, wir müssen doch weiter, wie es mich ansieht, vielleicht weiß es alles, könnte mich fragen, warum ich das mache, ihn schicke, Theseus, diesen Weg immer wieder, nie weiß er, wo lang, als wäre es das erste Mal, warum schaut es mich so an, könnt mich fragen, warum ich am Ende des Labyrinthes auf ihn warte, immer wieder, den Stoß des Horns lenke, das mit dieser schwingenden, langsamen Bewegung ihn, den Helden, in weit ausholendem Schwung ungebremst aufnimmt, wenn er aus dem dunklen Gang in die gleißende Helle tritt, immer ist der Platz hell wie am Mittag, und er geblendet wie ein Kind, hilflos, ahnt doch nichts, ich laß ihm keinen Moment zum Blinzeln, laß ihn ohne Warnung, halte das Horn und es rutscht mir unter der Hand, ganz leicht, nur ein wenig geführt, glatt durch, ihm in die Seite, in den Leib. Reißt ihn hoch. Schlimm reißt es ihn auf. Aber ungesehen. Ob das Mädchen das alles weiß, fragte er sich und senkte, als er bemerkte, daß es ihn noch immer ansah, wieder den Kopf zum matt im Dunkel versickernden Glanz der Spüle. Es könnte mich fragen, dachte er, warum ich ihm dann wieder helfe, ihm, nachdem die Wunde sich geschlossen hat, die Axt lenke in die Kuppe des Tiers, obwohl ich nicht will. Er sah auf und suchte den Blick des Mädchens, hielt ihm einen Moment mit einem dünnen, flatternden Lächeln stand, und flüsterte, „sieh ihn dir doch an“. Das Mädchen starrte unverwandt hinüber zu ihm und beobachtete die Bewegungen seiner Lippen im Halbdunkel der Theke, während es nicht aufhörte, Theseus, die Beine fest um seine Hüften geschlossen, im Nacken zu kraulen; legte, um ihn besser sehen zu können, ihren Kopf auf seine Schulter. „Sieh ihn dir an“, sprach er weiter, „wie schön er ist, wie er den Arm beugt und streckt, diesen Nacken, den du streichelst, schön ist er geworden; ich sag dir, wenn er dich hochhebt, kannst du das Meer riechen“. Er beugte sich vor, in das Restlicht hinein, das durchs Fenster fiel; auf dem Gesicht des Jungen spiegelten sich mit zunehmendem Dunkel immer leuchtender und greller die bunten Lichter des Flippers. „In seinen Augen das Staunen zu sehen“, flüsterte er, „die Angst, Wolken, die baumlose Hänge schattieren, ich seh mich nicht satt daran; weißt du, nicht in dem Moment, in dem das Horn ihn trifft, bereue ich die Geschichte, schön ist es, seinem Schmerz zuzusehen, der Verwunderung, daß ihm, dem Helden, das zustößt, nicht da zweifle ich, im Gegenteil, hoffe doch, ihn diesmal sterben lassen zu können; erst später ist er mir ekelhaft, wenn er zuschlägt, wenn die Wunde klafft, das Blut dem Tier spitz hervorleckt zwischen den Augen wie eine Zunge aus dem wunden Mund in der Stirn, und es dann fällt, ungeheuer langsam fällt es, scheint zu zögern, dann aber schnell, Blut in den Augen, ein wenig zittern die Beine noch nach, dann bereu ich es, ihm wieder geholfen zu haben, sein Metzgertriumph ist mir widerlich und ich möchte es ungeschehen machen, wieder, wieder einmal“. Ich wurde, je länger ich ihm zuhörte, immer unruhiger, denn ich bemerkte, daß er, kreiselnd und langsam noch, der Wirklichkeit näherkam, wurde mir der Möglichkeit bewußt, daß er schließlich, wenn er so weitermachte, mir plötzlich gegenüberstehen könnte. Doch noch sprach er, für sich, mit dem Mädchen, dem das Geflüster, das es nicht verstand, je länger es dauerte, immer selbstverständlicher wurde, bis es ihn schließlich nicht mehr beachtete und seinen Blick dort hinter der Theke, den das Dunkel auch beinahe schon verschluckt hatte, nicht mehr suchte. „Es tut mir leid“, entschuldigte er sich, „aber glaub mir, es war nicht möglich, ich weiß nicht warum, ihn ohne Angst zu machen, mit Gedächtnis, nicht diese jungen Augen in einem, der weiß, nicht die Kraft und die Herrlichkeit, er darf nichts ahnen, muß sich an den Faden halten, als wäre er wirklich sein Ausweg, verrat ihm nichts“, bat er, immer leiser, dachte nur mehr, nimm ihn mir nicht. Da beugte das Mädchen sich hinunter zu dem Jungen, flüsterte mit ihm und er stieß sich, die Beine des Mädchens öffneten sich bereitwillig, mit den Hüften vom Flipper ab; als das Mädchen herunterglitt, hörte er, daß es zu Theseus sagte, „geh nach links“. Ohne sich umzusehen ging der Junge zur Tür, zog sie auf und ließ sie sperrangelweit in eine Arretierung einrasten; kalt kam es herein; er verschwand unter dem fahlweißen Licht einer Straßenlampe. „Bleib, geh nicht“, bat er aus dem Dunkel hinter der Theke hervor, „nicht da lang, das ist der falsche Weg, ich weiß doch Anfang und Ende, komm mit mir, geh nicht“. Das Knäuel blieb auf dem Boden. Er ging langsam um die Theke herum und hob es auf. Der Flipper verschwand aus seinem Blick, als das Mädchen sich wegdrehte und zur Tür der Damentoilette ging. Theke und Fenster, die Bar und die Tür der Toilette sah er nicht mehr, als die Tür hinter dem Mädchen ins Schloß fiel; der Kopfschmerz hörte auf, sobald die Konturen, wie windstilles Wasser, sich endlich beruhigten, und er zwischen den blauen Wänden des Labyrinthes nur mehr den kühlen Nachtwind spürte. Blau sind die Wände, dachte er, und fällt auch von oben, blau hat es gesagt, ist der Himmel, hat recht, blau ist die Luft, nicht gelb, Nacht ist es, es glitzert der Sand wie Meer unter meinen Sandalen, doch trocken, so trocken und still, daß es Himmel sein könnte, doch der ist blau, sie hat recht, nicht gelb wie der Sand, gelb hat es gesagt, ist geil, Theseus‘ Schritte haben keinen Abdruck gelassen, das Tier hört man nicht, keinen Schrei, daß ich wüßte, ob ich ihm helfen muß, hör auch den Wind nicht, hör nur mich, gelb ist das Tier, blau sind die Wände, alle Wände, wieviele sind es, aus glasierten Ziegeln, blau ist die Luft, nichts ist wie sonst, nichts geht mehr aus, nichts hat mehr ein Ende. Der Faden ist schwer. Hilft er hinaus. Bei jedem Schritt schlug ihm die Tasche mit den Fackeln gegen die Kniekehlen. Er sah nicht, daß das Mädchen hinter der Bar erschien und die Beleuchtung einschaltete, grell flammten hinter dem Milchglas der Säule mit Flaschen und Gläsern Neonröhren auf, hörte nicht, daß die Musik wieder einsetzte, bemerkte die ersten Gäste nicht, die wenig später hereinkamen, stand den ganzen Abend bewegungslos neben der Theke und blinzelte, als versuchte er, einen undurchsichtigen Film von den Augäpfeln zu entfernen. In jener Nacht noch beschließ ich, ihn einen Namen finden zu lassen für sich selbst.